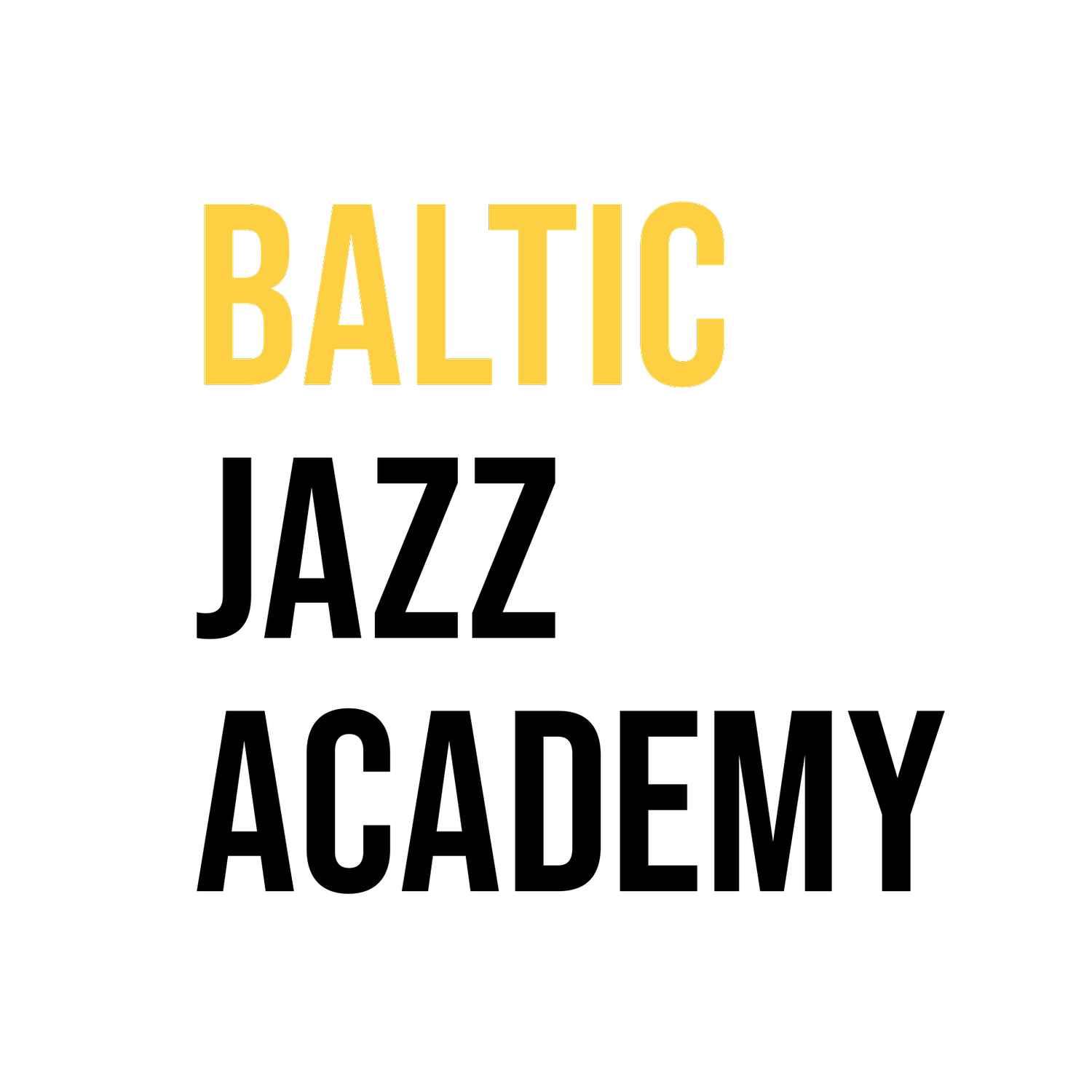Jazztheorie lernen
Wo fange ich an? Vier praktische Tipps
Jazz-Theorie klingt erstmal nach grauer Theorie und fühlt sich häufig total kompliziert an. Seltsame Bezeichnungen, uneindeutige Symbole und in jedem Leadsheet steht etwas anderes. Doch wer Jazz wirklich verstehen und sein Spiel weiterentwickeln möchte, kommt um ein paar solide Grundlagen nicht herum. Die gute Nachricht: Du musst kein Musikstudium absolvieren, um sie zu meistern. Mit den richtigen Schritten, dem passenden Fokus und einer Portion Offenheit und Neugier kommst Du schnell weiter.
Hier sind vier zentrale Schritte, die Dir helfen, die Grundlagen von Jazz-Theorie wirklich zu verstehen – und vor allem: musikalisch umzusetzen.
1. Verstehe die Bausteine: Die fünf wichtigsten 7er-Akkorde
Wenn du Jazz spielen willst, musst Du Akkorde verstehen. Akkorde sind Schichtungen aus Tönen, in der Regel Terzen. Achtung: Akkorde sind keine Theorie. Denn jeder Akkord hat einen charakteristischen Klang. Die Frage, was zuerst da war á la Henne oder Ei ersparen wir uns an dieser Stelle. Denn im Jazz zählt die Praxis! ;-)
Die meisten Jazz-Standards und Kompositionen bestehen aus sogenannten Vierklängen, also Akkorden mit vier Tönen Das sind in der Regel Grundton (1), Terz (3), Quinte (5) und Septime (7). Die fünf wichtigsten Typen:
maj7 (z. B. Cmaj7: C-E-G-B)
7 (Dominantseptakkord, z. B. C7: C-E-G-Bb)
-7/m7 (z. B. Cm7: C-Eb-G-Bb)
m7(b5) (Half-Diminished, z. B. C-Eb-Gb-Bb)
dim7 (z. B. C-Eb-Gb-Bbb)
Die fünf wichtigsten Akkordtypen
Diese Akkorde sind der Startpunkt für Dein Verständnis von Jazz-Harmonik. Wer sie aufbauen, benennen und auf dem Instrument umsetzen kann, hat den ersten großen Schritt geschafft. Mit der Zeit verinnerlichst Du die charakteristischen Klänge und verbindest Ohr und Finger.
2. Betrachte Tonleitern wie einen Malkasten aus Tönen statt eine technische Aneinanderreihung von Tönen
Tonleitern sind wichtig, aber sie sind kein Selbstzweck. Denke lieber an einen Malkasten aus Tönen – also Sammlungen von Tönen, die Dir zum kreativen Spiel zur Verfügung stehen. Egal ob von vorne bis hinten, rückwärts oder querbeet. Für jede Akkordart gibt es typische Skalen:
maj7 → Ionisch (Dur)
-7/m7 → Dorisch
7 → Mixolydisch oder Alteriert
m7(b5) → Lokrisch
dim7 → Ganzton-Halbton-dim
Die wichtigsten Skalen im Jazz: Dur, Mixolydisch & Moll
Die wichtigsten Skalen im Jazz: Halbvermindert & Halbton-Ganzton
Tipp: Lerne diese Skalen kennen, aber übe nicht nur rauf und runter. Verwende sie, um Melodien zu bauen, Ideen zu entwickeln und musikalisch zu denken. Skalen sind unser Rohmaterial – Musik entsteht erst durch Gestaltung.
3. Lerne die Kunst des Voice Leading mir Guide Tones
Zwei Töne sind entscheidend, um Akkorde klanglich zu verbinden: die Terz und die Septime. Das sind die sogenannten Leittöne (engl. Guidetones). Sie bestimmen, ob ein Akkord Dur oder Moll, Dominant oder etwas anderes ist.
Diese sogenannten Guide Tones helfen dir, Akkordfolgen mit einer guten Stimmführung (engl. Voice Leading) melodisch zu durchlaufen. In einer II-V-I-Verbindung zum Beispiel:
D-7: F (Terz), C (Septime)
G7: B (Terz), F (Septime)
Cmaj7: E (Terz), B (Septime)
Bringen Bewegung in Harmonik: Guide Tones
Die Töne bewegen sich meist schrittweise weiter. Wenn Du in Deinen Linien Guide Tones verbindest, entsteht eine melodische Logik, die stimmig klingt und überzeugt – selbst ohne Akkordinstrument.
4. Verstehe Akkordverbindungen – vor allem die »II-V-I«-Verbindung
Die DNA vieler Jazzstandards ist die »II-V-I-Verbindung«, die typischste Jazzkadenz. Sie ist der Schlüssel zu vielen Songs und hilft Dir, Akkorde nicht isoliert, sondern funktional zu sehen und zu hören. Akkorde sind manchmal statisch (bleiben liegen), bewegen sich aber genauso oft irgendwo hin.
Beispiel in C-Dur:
Dm7 (II)
G7 (V)
Cmaj7 (I)
Die berühmte »II-V-I-Verbindung«. Die häufigste Kadenz im Jazz.
Daneben gibt es auch andere :
Turnaround »I-VI-II-V« (z. B. C-Am7-Dm7-G7)
»II-V-I-Verbindung« in Moll (z. B. Dm7(b5)-G7alt-Cm7)
Je mehr Du Akkordfolgen als funktionale Zusammenhänge erkennst, desto freier wirst Du in der Improvisation. Du musst dann nicht jeden Akkord einzeln überlegen, sondern denkst in größeren Bögen.
Was Jazz-Theorie nicht ist
Jazz-Theorie ersetzt kein aktives Hören. Sie hilft Dir aber, Dinge, die Du hörst, zu benennen und zu verstehen. Sie ist aber kein Selbstzweck und sie ersetzt nicht das Spiel nach Gehör, das Transkribieren von Licks oder die praktische Erfahrung.
Sie ist wie die Grammatik einer Sprache: wichtig, um weiterzukommen, aber Sprechen lernst Du durch das Zuhören, Mitreden und Ausprobieren.
Fazit: Theorie ja – aber bitte angewandt & musikalisch!
Jazz-Theorie ist kein Buchwissen für Nerds. Sie ist ein Werkzeug, das Dir hilft, Musik besser zu verstehen, zu analysieren und gezielt zu gestalten.
Wenn Du die Grundlagen verinnerlichst, werden Dir Jazzstandards, Soli und Begleitungen viel leichter von der Hand gehen.